|
Früher war er fast in jedem Dorf zu Hause, heute ist er
nur noch in einzelnen Teilen Deutschlands verbreitet: Der Steinkauz (Athene
noctua), in der Roten Liste Niedersachsens mittlerweile in der Katagorie 1 (vom
Erlöschen bedroht) eingestuft. Bereits Ende Dezember 2007 wurde in
Niedersachsen ein Projekt gestartet, um die Restbestände dieser Eule zu schützen.
Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Staatlichen Vogelwarte,
der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung (NOV) und des NABU
Niedersachsens, der das Projekt koordiniert. Ziel ist die systematische
Erfassung der Bestände sowie eine positive Beeinflussung durch Biotop- und
Artenschutzmaßnahmen. Bei der Erfassung der Bestände ist der NABU neben den
ehrenamtlichen Erfassern auf die Hilfe von Haupt- und Nebenerwerbslandwirten
sowie Hobbytierhaltern angewiesen. Das Vorkommen des Steinkauzes ist nämlich
eng mit der Tierhaltung verbunden.
 Woran
erkennt man den Steinkauz, welches sind seine Lebensräume? Der Steinkauz ist
eine kleine, nur ca. 25 cm große Eule. Sie ist ganzjährig in ihrem Revier und
hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Typische Kennzeichen sind der runde
Kopf, die gelben Augen mit weißen Überaugenstreifen und das grau-braun
gesprenkelte Gefieder (siehe Foto). Die für die Waldohreule typischen
Federohren fehlen. Steinkäuze bleiben ihrem Partner und auch ihrem Revier in
der Regel ein Leben lang treu. Das typische Steinkauzrevier zeichnet sich durch
kurzrasiges, beweidetes Grünland aus und ist ein durch alte und höhlenreiche Bäume,
Hochstammobstwiesen, Hecken und Kopfbäumen gegliederter Lebensraum. Auch in
Dorfrandlagen und Steinbrüchen kann der Steinkauz vorkommen, Wälder meidet er
völlig. Woran
erkennt man den Steinkauz, welches sind seine Lebensräume? Der Steinkauz ist
eine kleine, nur ca. 25 cm große Eule. Sie ist ganzjährig in ihrem Revier und
hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Typische Kennzeichen sind der runde
Kopf, die gelben Augen mit weißen Überaugenstreifen und das grau-braun
gesprenkelte Gefieder (siehe Foto). Die für die Waldohreule typischen
Federohren fehlen. Steinkäuze bleiben ihrem Partner und auch ihrem Revier in
der Regel ein Leben lang treu. Das typische Steinkauzrevier zeichnet sich durch
kurzrasiges, beweidetes Grünland aus und ist ein durch alte und höhlenreiche Bäume,
Hochstammobstwiesen, Hecken und Kopfbäumen gegliederter Lebensraum. Auch in
Dorfrandlagen und Steinbrüchen kann der Steinkauz vorkommen, Wälder meidet er
völlig.
Besonders
gut lässt sich die Anwesenheit eines Steinkauzes zur Balzzeit feststellen.
Diese beginnt im zeitigen Frühjahr, teilweise schon Mitte Februar und dauert
bis Mitte April. In dieser Zeit grenzt das Männchen durch ausdauerndes Rufen
(„guhk“) sein Territorium gegen Artgenossen ab. Das Rufen beginnt ca. eine
Stunde vor Dämmerung und kann die ganze Nacht andauern (zu hören unter http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/vogeldesjahres/1972-dersteinkauz/).
 Die
Steinkäuze sitzen gerne auf sog. „Warten“, das können Pfosten, Schilder
und Weidepfähle sein. Sie zeigen auf ihrer Warte ein auffälliges
„Knicksen“, d.h. sie bewegen sich zur Fixierung ihrer Beute auf und ab. Die
Steinkäuze jagen vorwiegend zu Fuß. Der überwiegende Teil ihrer Beute besteht
aus Mäusen. Darüber hinaus werden Kleinvögel, Käfer, Reptilien und Amphibien
gejagt. Besonders zur Zeit der Jungenaufzucht werden auch Regenwürmer erbeutet.
Hier zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen dem Vorkommen des Steinkauzes und
beweideter bzw. gemähter Flächen: Nur auf kurzrasigem Terrain ist es dem Kauz
möglich, seine Beute zu erspähen und sie zu Fuß zu jagen.
Die Nisthöhle des Steinkauzes befindet sich überwiegend in Bäumen, z. B. in
ausgefaulten Astlöchern, Baumhöhlen oder Kopfweiden. Abweichend davon befindet
sich der Neststandort aber auch in Gebäuden, Felsspalten oder gut geschützt
auf dem Erdboden. Die Größe des Geleges schwankt, im Durchschnitt besteht es
aus 3 bis 5 Eiern. Die Jungvögel schlüpfen ca. Mitte Mai und werden dann von
beiden Altvögeln gefüttert. Die Bruthöhle wird ca. Mitte Juni verlassen, die
Jungvögel halten sich dann in der Nähe der Bruthöhle auf und werden weiter
gefüttert. Zu dieser Zeit lassen sich die Käuze ganztägig gut beobachten. Die
Steinkäuze sitzen gerne auf sog. „Warten“, das können Pfosten, Schilder
und Weidepfähle sein. Sie zeigen auf ihrer Warte ein auffälliges
„Knicksen“, d.h. sie bewegen sich zur Fixierung ihrer Beute auf und ab. Die
Steinkäuze jagen vorwiegend zu Fuß. Der überwiegende Teil ihrer Beute besteht
aus Mäusen. Darüber hinaus werden Kleinvögel, Käfer, Reptilien und Amphibien
gejagt. Besonders zur Zeit der Jungenaufzucht werden auch Regenwürmer erbeutet.
Hier zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen dem Vorkommen des Steinkauzes und
beweideter bzw. gemähter Flächen: Nur auf kurzrasigem Terrain ist es dem Kauz
möglich, seine Beute zu erspähen und sie zu Fuß zu jagen.
Die Nisthöhle des Steinkauzes befindet sich überwiegend in Bäumen, z. B. in
ausgefaulten Astlöchern, Baumhöhlen oder Kopfweiden. Abweichend davon befindet
sich der Neststandort aber auch in Gebäuden, Felsspalten oder gut geschützt
auf dem Erdboden. Die Größe des Geleges schwankt, im Durchschnitt besteht es
aus 3 bis 5 Eiern. Die Jungvögel schlüpfen ca. Mitte Mai und werden dann von
beiden Altvögeln gefüttert. Die Bruthöhle wird ca. Mitte Juni verlassen, die
Jungvögel halten sich dann in der Nähe der Bruthöhle auf und werden weiter
gefüttert. Zu dieser Zeit lassen sich die Käuze ganztägig gut beobachten.
Der
Rückgang des Steinkauzvorkommens liegt an der Zerstörung seines Lebensraumes,
seiner Niststandorte und Tagesverstecke (Rodung alter Obstbäume,
Auseinanderbrechen von Kopfbäumen, Abriss von Feldscheunen), der Intensivierung
der Landwirtschaft mit der Umwandlung von Grünland in Acker, die Ausweisung von
Baugebieten auf ehemaligen
Streuobstwiesen und durch die Gefährdung durch Verkehr und Stromschlag an
Stromleitungen. Der Steinkauz ist somit, genau wie viele Haustierrassen, ein
Opfer der intensivierten Landwirtschaft und der Abkehr des Verbrauchers von
regionalen Produkten. Solange Schafweiden am Dorfrand gehalten wurden,
Streuobstwiesen bewirtschaftet und damit auch gepflegt wurden, Kopfweiden zur
Herstellung von Korbwaren regelmäßig beschnitten wurden fehlten dem Kauz weder
Jagdgebiet noch Niststandorte.
Der
NABU bittet alle Mitglieder der GEH, Ihre Steinkauzbeobachtungen zu melden,
damit Mitarbeiter des Projektes Ihre Beobachtungen vor Ort überprüfen können
und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen wie z.B. das Aufhängen von Niströhren
einleiten können. Nicht nur Meldungen aus Niedersachsen sondern aus dem
gesamten Bundesgebiet sind hilfreich und werden von uns an die entsprechenden
Mitarbeiter weitergegeben.
Ihre
Ansprechpartner sind:
Mathias
Kumitz
, Sellhof
3c
, 38315
Schladen
, Tel.: 05335-80 86 96
, Mail: m.kumitz@web.de
NABU-Umweltpyramide
:Simone
Zukowski,
Am
Vorwerk 10
, 27432
Bremervörde,
Tel.: 04761-71330
oder
Mail:
s.zukowski@NABU-Umweltpyramide.de
|
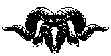
 Woran
erkennt man den Steinkauz, welches sind seine Lebensräume? Der Steinkauz ist
eine kleine, nur ca. 25 cm große Eule. Sie ist ganzjährig in ihrem Revier und
hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Typische Kennzeichen sind der runde
Kopf, die gelben Augen mit weißen Überaugenstreifen und das grau-braun
gesprenkelte Gefieder (siehe Foto). Die für die Waldohreule typischen
Federohren fehlen. Steinkäuze bleiben ihrem Partner und auch ihrem Revier in
der Regel ein Leben lang treu. Das typische Steinkauzrevier zeichnet sich durch
kurzrasiges, beweidetes Grünland aus und ist ein durch alte und höhlenreiche Bäume,
Hochstammobstwiesen, Hecken und Kopfbäumen gegliederter Lebensraum. Auch in
Dorfrandlagen und Steinbrüchen kann der Steinkauz vorkommen, Wälder meidet er
völlig.
Woran
erkennt man den Steinkauz, welches sind seine Lebensräume? Der Steinkauz ist
eine kleine, nur ca. 25 cm große Eule. Sie ist ganzjährig in ihrem Revier und
hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Typische Kennzeichen sind der runde
Kopf, die gelben Augen mit weißen Überaugenstreifen und das grau-braun
gesprenkelte Gefieder (siehe Foto). Die für die Waldohreule typischen
Federohren fehlen. Steinkäuze bleiben ihrem Partner und auch ihrem Revier in
der Regel ein Leben lang treu. Das typische Steinkauzrevier zeichnet sich durch
kurzrasiges, beweidetes Grünland aus und ist ein durch alte und höhlenreiche Bäume,
Hochstammobstwiesen, Hecken und Kopfbäumen gegliederter Lebensraum. Auch in
Dorfrandlagen und Steinbrüchen kann der Steinkauz vorkommen, Wälder meidet er
völlig.